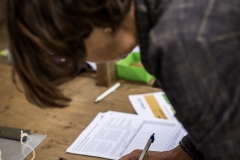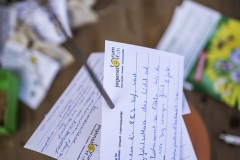Dorfrundgang mit GemeindevertreterInnen
| In Jegenstorf gibt es einige naturnah gestaltete öffentliche und private Grundstücke, die diversen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten. Dass für weitere Aufwertungen vor allem auch Behörden und Politik in der Pflicht sind, wurde an einer Führung für GemeindevertreterInnen klar. |
Das Forum hatte dazu Gemeinde- und Kirchgemeindebehörden, Wegmeister, ParteivertreterInnen und weitere Interessierte eingeladen. Rund zwei Dutzend Personen fanden sich am 11. September 2019 beim Bahnhof zu einem eineinhalbstündigen Dorfrundgang ein. Zu Beginn erläuterte Jan Ryser, der Geschäftsleiter von Pro Natura Bern die gesetzlichen Vorschriften und die Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden im Naturschutzbereich. Er zeigte auf, dass die Gemeinde hier viel Verantwortung und auch Spielraum hat, den es auszunutzen gilt.
Gute und weniger gute Beispiele im Dorf
Nach der Theorie ging es zur praktischen Anschauung unter der Leitung von Beat Haller vom Forum Jegenstorf. Beim Löwenplatz wies er auf die schöne Silberpapel hin, die mit ihrer strukturierten Rinde ökolologisch einen sehr hohen Wert bietet. Bei der Stampfimatt fällt u. a. die Gestaltung des Dorfbaches positiv auf, der Kindern ein naturnahes Spielen erlaubt, aber auch diversen Wasserlebewesen Unterschlupf bietet. Der Grasstreifen seitlich vom Coop ist klein, dank dem, dass er nicht als «englischer» Rasen gepflegt wird, enthält er aber eine Vielfalt an Pflanzen, die wiederum für viele Insekten Nahrung bieten. Solche Wildblumenstreifen könnten z. B. auch am Rand von Rasenflächen bei Blocküberbauungen wie im Säget einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Das gleiche gilt für Hecken mit gemischten einheimischen Sträuchern, die weit wertvoller sind, als die häufig anzutreffenden Kirschlorbeer- oder Thujahecken. Die Route führte zum Schluss zu zwei schönen Trockenbiotopen: demjenigen in der Rosenweg-Überbauung (die mit dem Qualitätszertifikat der Stiftung Natur und Wirtschaft ausgezeichnet ist) und dem artenreichen Biotop «Im Laufe der Zeit» beim Schlosseingang.
Erfahrungen aus Ittigen
Auf dem Schlossvorplatz berichtete zum Abschluss Martin Pauli, der Leiter des Bereichs Umwelt in Ittigen von den Erfahrungen in seiner Gemeinde mit ökologischen Aufwertungen. Er sieht diese auch im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels als äusserst dringend an. Für die Planung und Umsetzung solcher Aufwertungen müssen innerhalb der Gemeindebehörden entsprechende Verantwortlichkeiten und Strukturen geschaffen werden. Die Aufgaben dürfen nicht einfach an engagierte Private oder Vereine abgeschoben werden.
Fazit
Aus den verschiedenen Vorschlägen und Bemerkungen von Jan Ryser und Martin Pauli sowie den anschliessenden Diskussionen lassen sich folgende Schlüsse ziehen:
- Der gesetzliche Auftrag zum Naturschutz besteht, aber der politische Wille fehlt häufig.
- In der Gemeinde müssen Strukturen, Zuständigkeiten, Pflichtenhefte und die nötigen Budgets geklärt bzw. geschaffen werden.
- Eine für das Thema Umwelt und Natur zuständige Person in der Gemeindeverwaltung bzw. eine Umweltkommission sind wichtig.
- Wertvolle Lebensräume in der Gemeinde sollten erhoben und mit Verträgen geschützt werden.
- Jegenstorf verfügt bereits über geschützte Gebiete wie die Biotope Lindeholz in Münchringen und Eglismatt im «Spitalwald» (Glaschpe). Auch Aufwertungen sind erfolgt wie z. B. die Renaturierung von Teilen der Urtene oder die Eichenpflanzung im Gemeindewald (Bollwald). Ausserdem gibt es weitere wertvolle private Waldparzellen sowie artenreiche Wiesen.
- Auf öffentlichem und privaten Grund bestehen aber noch viele Möglichkeiten und viel Nachholbedarf in Bezug auf artenreiche Gestaltung.
- Zur Mitfinanzierung von ökologischen Aufwertungen dient in Jegenstorf die «Beitragsverordnung für ökologische Leistungen und die gestalterische Aufwertung des Ortsbildes» von 2012, die es dem Gemeinderat erlaubt, Beiträge an besondere Leistungen von GrundeigentümerInnen und BewirtschafterInnen in den Bereichen Ökologie und Ortsbildgestaltung auszurichten. Diese Finanzierungsmöglichkeit müsste breiter bekannt gemacht werden
Von den Referenten genannte Quellen
- Naturschutzgesetz des Kantons Bern
- Bundesamt für Umwelt/Bundesamt für Raumplanung (2018): Hitze in Städten. Grundlage für eine klimaangepasste Stadtentwicklung.
- Bundesamt für Umwelt (Hrsg.) (2019): Planungshilfe Grün- und Freiflächen. Handlungsspielraum und Hilfsmittel für die Planung, Umsetzung und Bewirtschaftung.
Bericht: Marianne König